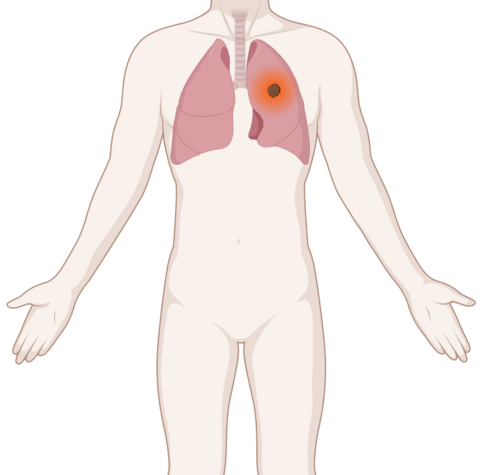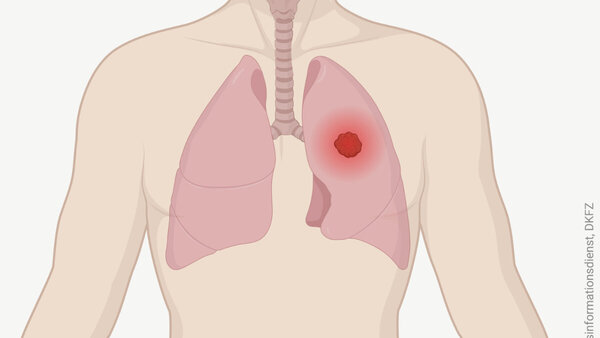- Wie sich die Diagnose Lungenkrebs auf das Leben und den Alltag der Betroffenen auswirkt, hängt sehr davon ab, wie weit der Krebs fortgeschritten ist.
- Beschwerden durch die Erkrankung selbst und die Nebenwirkungen der Lungenkrebs-Therapie können die Rückkehr in den Alltag erschweren.
- Wir fassen zusammen, was Patientinnen und Patienten tun können, um die Lebensqualität zu verbessern, den Alltag aktiv zu gestalten und das Risiko eines Rückfalls zu verkleinern.
Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.
Nach der Therapie: Für sich selbst sorgen

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt
Nach der medizinischen Behandlung wollen viele Lungenkrebspatientinnen und -patienten selbst etwas für sich tun, das Leben wieder in die eigene Hand nehmen. Was ihnen gut tut und die Heilung unterstützt, was eher schadet, hängt von der individuellen Situation ab.
Bewegung, Entspannungstechniken und gutes gesundes Essen können helfen, besser mit den Folgen von Krankheit und Therapie zurecht zu kommen.
Eine psychologische Beratung kann dabei unterstützen, Sorgen und Ängste besser zu verarbeiten.
Wer unter belastenden Symptomen leidet, braucht eine gute unterstützende Behandlung, um seine Lebensqualität zu verbessern. Um zu klären, was und wer einem in der eigenen Situation helfen kann, sollte man mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sprechen.
Eines wird von allen Fachleuten empfohlen: Spätestens jetzt sollten Betroffene mit dem Rauchen aufhören. Raucherinnen und Raucher leiden nach der Therapie fast dreimal häufiger unter Komplikationen als Nichtraucher. Außerdem kann Rauchen das Risiko für einen Zweittumor erhöhen. Rauchen Patienten mit SCLC nach der Therapie weiter, ist ihr Risiko etwa dreimal so hoch wie das von Betroffenen, die das Rauchen mit der Diagnose aufgeben.
Zum Weiterlesen
Mehr zu belastenden Symptomen bei Lungenkrebs, finden Sie im Abschnitt "Belastende Symptome: Die Lebensqualität verbessern" unter Lungenkrebs: Behandlungsmöglichkeiten und Nebenwirkungen.
Informationen zu belastenden Symptomen, die bei Krebspatienten allgemein auftreten können, haben wir zusammengefasst unter Nebenwirkungen und belastende Symptome bei Krebs.
Familie, Freunde, Arbeitsplatz
Familie und Freunde können eine wichtige Stütze sein, um eine Krebserkrankung nicht mit sich alleine auszumachen. Sie leiden aber auch mit.
Tipps für Patienten und Angehörige finden Sie unter:
Beruflicher Wiedereinstieg: Auch am Arbeitsplatz kann die Erkrankung zum Thema werden. Zum Beispiel, wenn Betroffene länger fehlen oder nach der Rückkehr nicht gleich wieder voll einsteigen. Denn nach einer Krebserkrankung in den Beruf zurückzukehren, ist nicht immer so einfach wie vielleicht zuerst angenommen.
Auch für rechtliche und berufliche Fragen gibt es Ansprechpartner, die konkrete Hilfe vermitteln oder Lösungsansätze aufzeigen.
- Mehr zum Thema unter Arbeiten mit einer Krebserkrankung
Ernährung: Ausreichend und gesund essen
Es gibt keine Krebsdiät
Bis jetzt gibt es keinen Beweis dafür, dass man einen Tumor mit einer speziellen Ernährung aushungern oder bekämpfen kann, auch wenn manche Anbieter damit werben.
Wichtiger ist durch gutes, ausgewogenes Essen bei Kräften zu bleiben, damit man die Behandlungen und deren Nebenwirkungen gut übersteht. Mehr dazu unter Essen nach Vorschrift: Lässt sich Krebs durch eine Diät beeinflussen?.
Eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und Obst senkt das Risiko Krebs zu entwickeln, ist also vorbeugend. Da man nicht genau weiß, welche Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel das Risiko senken, kann man die Wirkung auch nicht mit Vitamintabletten oder Nahrungsergänzungsmitteln erzielen. Im Gegenteil. Einige Studien haben gezeigt, dass eine Einnahme beispielsweise von B6, B12 oder ß-Carotin das Risiko für Krebs erhöhen kann.
Für Menschen, die bereits Lungenkrebs haben, ist etwas anderes wichtiger: Kräfte sammeln und möglichst das Gewicht halten. Das kann eine Herausforderung sein, denn viele Lungenkrebspatientinnen und -patienten leiden unter Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust. Darum lautet das Motto: Essen was schmeckt und was man gut verträgt – damit die Freude am Essen nicht vergeht. Reicht das allein nicht, kann die Ärztin oder der Arzt hochkalorische Zusatznahrung verschreiben, wie die sogenannte Astronautennahrung. Eine fundierte Ernährungsberatung kann Betroffenen und Angehörigen helfen, kalorienreich und trotzdem ausgewogen zu kochen.
- Mehr dazu unter Ernährungsberatung und Ernährungstherapie bei Krebs
Wenn das Gewicht normal ist und der Gesundheitszustand sich stabilisiert hat, können Betroffene wieder so wie Gesunde, gesund und ausgewogen essen.
Bewegung: Gut für Körper und Seele

Bild: © janeb13, Pixabay
Bewegung und Sport verbessern nicht nur das Wohlbefinden, sondern erhöhen auch die Belastbarkeit. Das gilt auch für Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs. Schon leichte körperliche Aktivität kann die Lebensqualität verbessern und belastende Symptome mildern. Meist beginnen Betroffene mit Physiotherapie und Atemtraining schon im Krankenhaus. Wieder zuhause können sie das Training in einer Sportgruppe für Krebspatientinnen und -patienten oder eine Lungensportgruppe weiterführen.
Intensität der Bewegung an die eigene Leistungsfähigkeit anpassen: Wie hoch die Intensität der körperlichen Aktivität sein kann, hängt davon ab, wie gut man sich erholt hat, wie gut die Lungenfunktion ist und ob es Zeichen für einen Rückfall gibt. Da körperliche Aktivität Kalorien verbraucht, spielt auch das Gewicht eine Rolle. Hat man zu viel Gewicht verloren, spricht das eventuell gegen ein solches Training. Bevor man mit dem Training beginnt, sollte man mit dem behandelnden Arzt besprechen, welche und wieviel Bewegung gut ist.
Informieren Sie sich
Bevor Sie mit dem Training beginnen, sollten Sie mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem behandelnden Arzt besprechen, welche und wieviel Bewegung gut ist.
Spricht nichts gegen körperliche Aktivität, gilt: Verordnet der Arzt oder die Ärztin Rehasport, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen oder die Rentenversicherung die Kosten. Er oder sie muss dafür jedoch in der Verordnung begründen, dass das Bewegungstraining medizinisch notwendig ist. Einen Eigenanteil müssen Patientinnen und Patienten nicht bezahlen.
Eine spezielle Lungensportgruppe in Ihrer Nähe finden Sie auf der Internetseite der Arbeitsgemeinschaft Lungensport in Deutschland e. V..
Zum Weiterlesen
Achtsamkeit: Zur Ruhe kommen

Bild: © ZephyrMedia, Shutterstock
Sogenannte Mind-Body-Verfahren aus dem Bereich der Komplementärmedizin können für Betroffene mit Lungenkrebs eine gute Möglichkeit darstellen, etwas für sich selbst zu tun.
Es gibt Hinweise darauf, dass gezielte Entspannung und Achtsamkeitsübungen belastende Symptome mildern können, die durch die Krankheit oder die Behandlung ausgelöst wurden etwa Fatigue. Darüber hinaus können sie helfen, Ängste oder Niedergeschlagenheit zu mindern. Dadurch steigt die Lebensqualität.
Geeignete Techniken sind zum Beispiel Yoga, Tai-Chi, progressive Muskelentspannung oder Meditation. Sie sollten unter fachkundiger Anleitung und nach Absprache mit den behandelnden Ärzten durchgeführt werden. Dann sind Risiken durch diese Methoden sehr unwahrscheinlich.
Sie interessieren sich für weitere komplementäre oder alternative Methoden?
Im Abschnitt "Komplementäre oder alternative Therapien bei Lungenkrebs" unter Lungenkrebs: Behandlungsmöglichkeiten und Nebenwirkungen haben wir Informationen zu anderen komplementären Methoden wie Akupunktur oder pflanzlichen Mitteln zusammengefasst.
Sie haben Fragen zum Nutzen und den Risiken einzelnen Methoden? Unsere Ärztinnen und Ärzte helfen Ihnen mit Hintergrundinformationen weiter:
- am Telefon kostenlos unter 0800 – 420 30 40, täglich von 8 bis 20 Uhr
- per Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de (datensicheres Kontaktformular)
Auch die Patientenleitlinie Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen Patienten bewertet die wichtigsten Methoden und Substanzen, die zur komplementären und alternativen Medizin zählen.
Ansprechpartner: Hier finden Sie Hilfe
Kliniksozialdienst: Beratung schon im Krankenhaus
Wichtig zu wissen
Termine mit dem Kliniksozialdienst können Patientinnen und Patienten über die Stationsleitung, die Ärzte oder Pflegenden ausmachen.
Die meisten Krankenhäuser bieten Patientinnen und Patienten während des stationären Aufenthaltes eine Beratungsmöglichkeit durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an.
Dabei können Kliniksozialdienste helfen:
- Sie sind Ansprechpartner für Fragen zur Krankenversicherung und zur Beantragung von Rehabilitationsmaßnahmen.
- Soll eine Krebspatientin oder ein Krebspatient nach Hause entlassen werden, unterstützen sie bei der Organisation der notwendigen Versorgung.
- Sie beraten, wenn Betroffene befürchten, durch die Erkrankung in eine finanzielle oder andere Notlage zu geraten.
- Auch wenn die Situation am Arbeitsplatz geklärt werden muss, können die Kliniksozialdienste weiterhelfen.
- Außerdem können sie über die Anerkennung einer Schwerbehinderung informieren und bei der Antragstellung helfen.
Krankheitsbewältigung bei Lungenkrebs

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt
Nach der Diagnose einer Krebserkrankung setzen sich fast alle Betroffenen mit bedrohlichen Gefühlen und Gedanken auseinander. Die Erkrankung wird als massiver Einschnitt erlebt. Furcht, dass der Krebs fortschreitet oder wiederkommt, haben die meisten Betroffenen irgendwann, auch diejenigen, die voraussichtlich geheilt werden können.
Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs sind häufig davon betroffen, dass ihre Erkrankung erst in einem weit fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird. Sie müssen dann damit rechnen, dass sich das Fortschreiten der Erkrankung zwar verlangsamen lässt, aber keine Heilung mehr möglich ist.
Niemand muss die Sorgen und Ängste wegen der ungewissen Zukunft allein tragen:
- Hilfe bekommen Patientinnen, Patienten und Angehörige schon im Krankenhaus. In den Lungenkrebszentren und den meisten anderen spezialisierten Kliniken arbeiten in Kliniksozialdiensten auch Psychoonkologinnen und Psychoonkologen.
- Patientinnen und Patienten, die ambulant behandelt werden, können sich an die regionalen Krebsberatungsstellen wenden. Das Angebot richtet sich auch an Angehörige. Die Beratung ist in der Regel kostenlos oder erfolgt gegen einen geringen Unkostenbeitrag. Eine Krebsberatungsstelle vor Ort finden Sie unter Psychosoziale Krebsberatungsstellen: Unterstützung, Beratung, Information.
- Möchten Krebserkrankte eine längerfristige Betreuung, sind niedergelassene Psychoonkologinnen und Psychoonkologen wichtige Ansprechpersonen. Wenn die behandelnden Ärzte eine entsprechende Überweisung ausstellen, können die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Der Krebsinformationsdienst bietet eine deutschlandweite Adressliste von Psychoonkologie-Praxen unter Praxen ambulant psychotherapeutisch tätiger Psychoonkologen: Unterstützung für Krebspatienten und ihre Angehörigen.
Zum Weiterlesen
Mehr Informationen zur Bewältigung der psychischen und seelischen Folgen einer Krebserkrankung bietet der Text Krankheitsbewältigung: Belastungen verkraften, Orientierung schaffen, Lebensqualität gewinnen.
Für Verwandte und Freunde von Patientinnen und Patienten hat der Krebsinformationsdienst einen eigenen Text erarbeitet, Krebs: Hilfe für Familie, Angehörige und Freunde.
Selbsthilfegruppen
Erfahrungen, die andere Betroffene mit Lungenkrebs machen oder gemacht haben, können ganz individuell und doch hilfreich sein: In Selbsthilfegruppen kann man Informationen und praktische Tipps bekommen, sich aber auch austauschen und Zuspruch oder Trost finden.
Bundesverband Selbsthilfegruppe Lungenkrebs e.V.: Er will Lungenkrebs-Patientinnen und -Patienten informieren und helfen, mit ihrer Erkrankung besser fertig zu werden. Auf deren Website finden sich in fast 40 Orten Ansprechpartner für lokale Selbsthilfegruppen.
ZielGENau e.V. ist Partner und Patientenforum des Nationalen Netzwerk Genomische Medizin Lungenkrebs (nNGM). Der Verein stellt Hilfe und Unterstützung für Menschen bereit, die an Lungenkrebs erkrankt sind und auf Basis einer molekularen Diagnostik personalisiert behandelt werden. Das nNGM wird von der Deutschen Krebshilfe gefördert.
Wichtig zu wissen
Über regionale Selbsthilfegruppen informieren darüber hinaus beispielsweise die örtlichen Krebsberatungsstellen. Betroffene können sich zudem auch an Selbsthilfegruppen wenden, die nicht auf eine Tumorart festgelegt sind.
- Adressen und Links: Selbsthilfeorganisationen und Patientenverbände
Palliativmedizin: Hilfe in der letzten Lebensphase
Fachleute für palliative Medizin begleiten schwer kranke und sterbende Menschen – nicht nur in der letzten Lebensphase. In der Palliativmedizin arbeiten Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen zusammen: Ärzte, Pflegefachleute, Psychologinnen und Psychologen, Seelsorger und ehrenamtliche Sterbebegleiter. Sie versuchen, Erkrankte und Angehörige in ihrer schwierigen Situation zu unterstützen.
Palliativmedizinnerinnen und -mediziner sind erfahren in der Schmerztherapie und in der Behandlung von belastenden Symptomen. Sie helfen Patientinnen und Patienten, bis zuletzt eine möglichst gute Lebensqualität zu bewahren und in Würde zu sterben. In der letzten Lebensphase kümmern sich Fachkräfte für palliative Pflege um die Betreuung der Betroffenen und helfen Angehörigen bei der Pflege zu Hause.
- Hintergrundinformationen sowie Hinweise auf wichtige Ansprechpartner bietet das Informationsblatt “Fortgeschrittene Krebserkrankung: Behandlung, Pflege und Betreuung” (PDF).
- Weitere Adressen und Informationen sind unter Palliative Versorgung: Organisation, Ansprechpartner, rechtliche Informationen zusammengestellt.
Zum Weiterlesen
Welche palliative Behandlungsmöglichkeiten es bei Lungenkrebs gibt und was das palliative Therapiekonzept für Betroffene bedeutet, erfahren Sie im Abschnitt "Wenn Lungenkrebs nicht heilbar ist" unter Lungenkrebs: Behandlungsmöglichkeiten und Nebenwirkungen.
Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise
Hinweis: Dieser Text wurde anhand der neuen medizinischen Leitlinie vollständig auf seine Aktualität überprüft. Da der Inhalt dem Stand dieser Leitlinie entspricht, wurden keine fachlichen Änderungen vorgenommen.
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.
Quellen und weiterführende Informationen
Leitlinien
Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatient*innen, Langversion 2.1, 2023, AWMF-Registernummer: 032-051OL, abgerufen am 12.06.2025
Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Patientenleitlinie Palliativmedizin, Stand: November 2021, Artikel-Nr. 198 0012, abgerufen am 12.06.2025