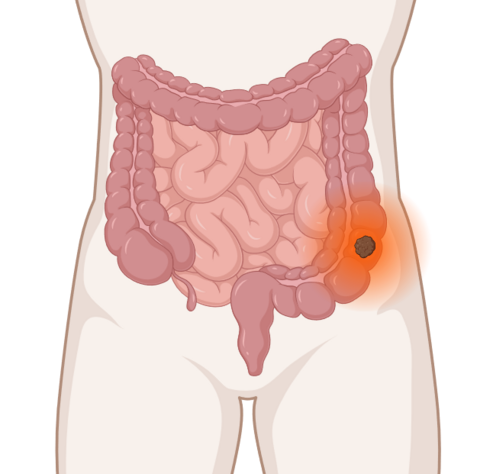- Darmkrebs kann das Leben Betroffener verändern. Die Krankheit selbst oder die Therapie können den Alltag beeinflussen.
- Das betrifft zum Beispiel die Ernährung nach einer Operation: Patientinnen und Patienten fragen sich vielleicht, wie sie sich jetzt am besten ernähren können. Wer ein Stoma bekommen hat, muss den Umgang damit erst lernen.
- Welche Herausforderungen auf Menschen mit Darmkrebs zukommen und wie sie damit umgehen können, erläutern wir in diesem Text.
Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.
Ernährung nach Darmkrebs
Durch Erkrankung und Therapie verändert sich bei vielen Darmkrebserkrankten der Appetit. Eventuell vertragen sie zumindest zeitweilig nicht mehr alle Lebensmittel so wie bisher. Der Körper muss sich erholen und auf die neue Situation einstellen. Nach einiger Zeit kommen die meisten Betroffenen mit der Ernährung wieder gut zurecht. Manche haben jedoch längerfristig mit Beschwerden zu kämpfen.
Nach einer Operation: Meist dauert es eine Weile, bis der Darm wieder normal funktioniert. In dieser Zeit vertragen die meisten Menschen viele Lebensmittel schlechter als gewohnt. Die Folge ist Unwohlsein, hinzu kommen Verdauungsprobleme wie etwa Durchfall, Verstopfung, starke Blähungen oder laute Darmgeräusche.
Bei Patientinnen und Patienten mit Enddarmkrebs kann häufiger und heftiger Stuhldrang belastend sein. Für Betroffene, die einen künstlichen Darmausgang erhalten, können Ernährungsprobleme zumindest anfangs den Alltag besonders beeinträchtigen: Sie müssen erst herausfinden, was ihnen guttut und was nicht.
Bei und nach einer Chemotherapie oder einer Bestrahlung: Während der Therapie ist eine ausgewogene Ernährung für viele Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs schwierig: Der Appetit leidet, Übelkeit ist möglich, und die Darmschleimhaut kann sich entzünden.
Was tun bei Schwierigkeiten mit der Ernährung?

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt
Besonders während der Behandlung und kurz danach ist Geduld erforderlich: Bei vielen Betroffenen normalisieren sich nach einiger Zeit Verträglichkeit und Verdauung von selbst. Patientinnen und Patienten mit einem Stoma lernen mit zunehmender Erfahrung mehr und mehr, welche Lebensmitteln sie gut vertragen und welche vielleicht weniger.
Ganz wichtig ist es, sich nicht unter Druck zu setzen. Bei Appetitlosigkeit oder therapiebedingten Problemen ist es sinnvoll, vorübergehend nur zu essen, worauf man tatsächlich Lust hat und was man gut verträgt. Dies gilt selbst dann, wenn die Zusammenstellung der Ernährung zeitweilig nicht sehr "gesund" ist.
Langfristig gilt aber: Lebensmittel, die anfangs Beschwerden verursachen, sollten Betroffene immer wieder in kleinen Mengen ausprobieren. Es kann durchaus sein, dass Speisen, die zunächst Probleme machen, später besser bekömmlich sind. So wird es auch nach und nach wieder leichter, sich ausgewogen zu ernähren.
Unterstützung suchen
Für Betroffene ist es sinnvoll, sich Unterstützung zu suchen:
- Mit den Ärzten sollten sie besprechen, wie sie sich schrittweise wieder normalen Mahlzeiten annähern können. Ein solches Gespräch ist schon im Krankenhaus möglich. In vielen großen Zentren gibt es auch Spezialsprechstunden zu Ernährungsfragen.
- Auch während einer Rehabilitation gibt es zu einer solchen Beratung Gelegenheit. In den Reha-Kliniken werden Ernährungskurse angeboten, die speziell auf die Bedürfnisse von Darmkrebserkrankten zugeschnitten sind.
- Zuhause kommt eventuell eine ambulante Ernährungsberatung infrage. Ärzte oder die Krankenversicherung können Adressen vermitteln und wegen der Kosten informieren.
- Patientinnen und Patienten finden außerdem Information und Unterstützung bei Selbsthilfegruppen, insbesondere bei der Deutschen ILCO e.V.
Kostenlose deutschsprachige Broschüren zum Thema Ernährung hat der Krebsinformationsdienst in der Rubrik Service zusammengestellt.
Was tun bei Gewichtsverlust?
Viele Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs verlieren rund um ihre Behandlung mehr oder weniger stark an Gewicht. Meist normalisiert sich das Gewicht nach einiger Zeit von allein wieder.
Wer längerfristig untergewichtig bleibt, sollte mit der Ärztin oder dem Arzt über mögliche Ursachen sprechen: Untergewicht ist zwar nicht zwangsläufig gesundheitsschädlich. Wer zu wenig wiegt, ist jedoch oft körperlich weniger belastbar. Ein geringes Körpergewicht kann auch ein Hinweis auf eine Mangelversorgung mit wichtigen Nährstoffen sein. Mit Ärztin oder Arzt sollten Betroffene besprechen, welche Maßnahmen sinnvoll sind, um wieder ein möglichst normales Gewicht zu erreichen.
Fortgeschrittene Erkrankung: Schwieriger kann das für Patientinnen und Patienten mit weiter fortgeschrittenem Darmkrebs sein: In dieser Situation beeinflussen meist noch andere Faktoren Appetit und Essverhalten, etwa Schmerzen oder Übelkeit und Verdauungsprobleme. Ein fortschreitender Gewichtsverlust und Mangelernährung beeinträchtigen den Allgemeinzustand und können sogar zum Abbruch einer Therapie führen.
Betroffene benötigen eine auf ihre besonderen Bedürfnisse ausgerichtete Behandlung und Ernährung, um den krankheitsbedingten Gewichtsverlust möglichst in Grenzen zu halten.
Kann man Rückfällen durch Ernährung vorbeugen?
Nach heutigem Kenntnisstand lässt sich die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls nicht durch eine Diät oder durch den Verzehr bestimmter Lebensmittel beeinflussen.
Viele der im Internet oder in Büchern beworbenen Krebsdiäten erlegen Betroffenen zudem unnötige Beschränkungen beim Essen auf. Oder sie nehmen zu wenig Rücksicht auf die individuelle Lage, zum Beispiel auf die Situation von Stomaträgern. Krebsdiäten können sogar gefährlich sein, weil sie zu einseitig sind und zu einer Mangelernährung führen können.
Fachleute empfehlen Betroffenen stattdessen, sich möglichst abwechslungsreich zu ernähren: mit viel Obst und Gemüse, mit Getreideprodukten und Hülsenfrüchten, aber mit wenig Fleischprodukten und Fett. Auch Alkohol sollte man nicht täglich und nur in Maßen konsumieren. Eine Orientierung bieten die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Eine weitere Empfehlung: Betroffene sollten ein möglichst normales Gewicht anstreben. Hier spielt die Energiebilanz eine wichtige Rolle. Es zählt also nicht nur, was man isst, sondern auch, wie viel Energie man verbraucht.
- Wer Übergewicht hat, sollte daher auf eine weniger energiereiche, kalorienärmere Ernährung und mehr Bewegung achten.
- Bei Untergewicht sollten Betroffene sich mit Ärztin oder Arzt beraten, ob damit gesundheitliche Beeinträchtigungen verbunden sein könnten. Gegebenenfalls ist eine spezielle Ernährungstherapie erforderlich.
Was lässt sich erreichen? Gesunde, ausgewogene Ernährung, Normalgewicht und ausreichend Bewegung sind ganz allgemein wichtig, nicht nur mit Blick auf das Thema Krebs. Ob sich so aber auch das Rückfallrisiko senken lässt, wird unter Fachleuten zurzeit viel diskutiert. Erste Studiendaten zeigen: Es spricht einiges dafür, aber noch gibt es keine aussagekräftigen Belege.
Übergewicht könnte das Rückfallrisiko steigern, während viel Bewegung das Risiko senkt. Untergewicht beeinträchtigt dagegen womöglich die körperliche Belastbarkeit bei einer Krebserkrankung. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass eine ballaststoffreiche Ernährung die Heilungschancen nach einer Darmkrebserkrankung steigert.
Helfen Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel?
Viele Krebserkrankte möchten ihrer Gesundheit etwas Gutes tun: Sie nehmen Vitamine, Mineralstoffe oder andere Nahrungsergänzungsmittel ein. Einen nachgewiesenen Nutzen oder gar Schutz vor einem Rückfall bieten solche Mittel aber nicht. Fachleute empfehlen daher auch Menschen mit Darmkrebs, solche Produkte nicht auf eigene Faust einzunehmen.
Nur in besonderen Situationen kann eine zeitweilige Nahrungsergänzung sinnvoll sein, etwa wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Das sollte man aber zuerst mit seiner Ärztin oder seinem Arzt abklären. Diese können entsprechende Untersuchungen durchführen und eine diagnostizierte Unterversorgung gezielt therapieren.
Mangelernährung durch einen verkürzten Darm?
Nach der Operation fehlt Betroffenen ein mehr oder weniger großes Stück Dick- oder Enddarm. Angst vor einer Mangelversorgung mit Nährstoffen müssen die Allermeisten dennoch nicht haben: Der überwiegende Teil der Nährstoffaufnahme findet im Dünndarm statt. Im von der Operation betroffenen Dick- und Enddarm wird der Stuhl nur noch eingedickt.
Wurden größere Dickdarmteile entfernt, kann es allerdings sein, das Betroffene zumindest anfangs an Durchfall leiden. Grund dafür ist, dass dem Stuhl nicht genügend Wasser entzogen wird. Das kann dann zum Beispiel den Salzhaushalt des Körpers durcheinander bringen.
Bei den meisten Patienten gewöhnt sich der Darm mit der Zeit an die neue Situation, und die Durchfälle bessern sich. Bis es soweit ist, sollte man sich nicht auf Hausmittel verlassen. Auch weniger zu trinken, hilft nicht: Um nicht auszutrocknen und den Mineralstoffhaushalt auch nicht ganz durcheinander zu bringen, sollte man die verlorene Flüssigkeit dagegen zügig ersetzen.
Wichtig ist die Rücksprache mit den Ärzten: Sie können Ernährungstipps geben und, wenn notwendig, stuhlverdickende Medikamente verschreiben.
Anders sieht es für Betroffene aus, denen der Großteil des Dickdarms entfernt werden musste, etwa aufgrund eines genetisch bedingten hohen Krebsrisikos. Zwar müssen auch sie keinen Nährstoffmangel befürchten. Aber der Stuhl lässt sich nur sehr bedingt durch geeignete Lebensmittel "eindicken". Betroffene müssen auf Dauer damit leben, dass ihr Flüssigkeits- und Salzhaushalt leichter durcheinander geraten kann. Auch diese Situation lässt sich mit entsprechender Schulung und zunehmender Erfahrung jedoch gut meistern.
Zum Weiterlesen
Stoma: Künstlicher Darmausgang

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt
Die Operationsverfahren für Darmkrebspatienten haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Trotzdem muss immer noch ein Teil der Betroffenen mit Enddarmkrebs damit rechnen, dass ihr Schließmuskel nicht erhalten bleiben kann. Betroffene erhalten dann dauerhaft einen künstlichen Darmausgang: ein sogenanntes Stoma, auch Kolostoma oder Anus Praeter genannt.
Bei anderen Patientinnen und Patienten mit Dick- oder Enddarmkrebs kann ein vorübergehender künstlicher Darmausgang notwendig werden, um dem Gewebe Zeit zur Heilung zu geben. Wann der Darmausgang wieder zurückverlegt werden kann, hängt von der individuellen Situation ab.
Eine besondere Form des Stomas benötigen zum Beispiel Betroffene, bei denen große Teile des Dickdarms wegen ihres hohen genetischen Krebsrisikos entfernt werden müssen: Sie erhalten ein sogenanntes Ileostoma. Es schließt sich mehr oder weniger direkt an das Ende des Dünndarms an. Dadurch entfällt die Eindickung des Stuhls, die normalerweise im Dickdarm stattfindet. Daher benötigen Betroffene andere Materialien zur Versorgung als Patientinnen und Patienten mit einem Kolostoma.
Egal ob dauerhaftes oder zeitweises Stoma: Der Umgang mit dem künstlichen Darmausgang erfordert zunächst viel Übung. Betroffene müssen die Handhabung der notwendigen Hilfsmittel erst erlernen und Erfahrung sammeln, wie sie sich im Alltag damit zurechtfinden. Und es dauert einige Zeit, bis man herausgefunden hat, welche Lebensmittel man gut verträgt und welche Probleme machen.
Unterstützung beim Umgang mit dem Stoma
In der Klinik: Bereits im Krankenhaus zeigen besonders dafür ausgebildete Pflegekräfte, sogenannte Stomatherapeuten, den Umgang mit Beuteln und dem entsprechenden Befestigungsmaterial. Wichtig sind auch Hautschutzmaterialien, etwa zum Abkleben, und Pflegeprodukte sowie weiteres Zubehör.
Die Stomatherapeutinnen und -therapeuten geben Tipps, wie man das für sich am besten geeignete Stomasystem findet, wie man die Haut um den künstlichen Darmausgang herum pflegt, und wie man bei einem Kolostoma unter Umständen durch eine tägliche Spülung des Dickdarms die Zeitabstände zwischen den Darmentleerungen und dem Wechsel der Versorgung verlängern kann.
Bei der Reha: Es gibt Reha-Einrichtungen, die besonders auf Stomaträger eingestellt sind. Auch hier erhalten Patientinnen und Patienten Hilfestellung und Beratung durch erfahrene Fachkräfte. Weitere Unterstützung bietet der Kontakt zu anderen Betroffenen: Mit ihnen kann man sich über Erfahrungen im Umgang mit ganz praktischen Problemen austauschen und Tipps für den Alltag bekommen.
In Selbsthilfegruppen: Andere Betroffene, die bereits viele praktische Erfahrungen gesammelt haben, können unterstützen und beraten. Es gibt verschiedene Angebote für Darmkrebsbetroffene und Menschen mit Stoma.
Den Alltag mit Stoma meistern
Die Anlage eines künstlichen Darmausgangs bedeutet für die meisten Betroffenen eine große Veränderung. Auch wenn es anfangs schwer erscheint: Die allermeisten Menschen mit einem Stoma können nach einer Zeit der Eingewöhnung ganz normal am Alltagsleben teilnehmen. Eine normale Ernährung, Berufstätigkeit, die gewohnten Freizeitaktivitäten, Reisen oder viele Sportarten sind möglich. Auch einem erfüllten Sexualleben muss das Stoma nicht im Weg stehen. Für jüngere Frauen ist eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen.
Studien zeigten, dass die meisten Darmkrebserkrankten, die einen künstlichen Darmausgang bekommen haben, eine ebenso gute Lebensqualität erreichen wie andere Betroffene. Unter Umständen ist man im Alltag mit einem Stoma sogar weniger eingeschränkt, als es bei erhaltenem Schließmuskel, aber langfristigen Problemen mit der Kontinenz der Fall wäre.
Den idealen oder einzig richtigen Weg dahin gibt es jedoch nicht: Hier zählt vor allem die persönliche Erfahrung.
Zum Weiterlesen
Inkontinenz (Probleme mit der Stuhlkontrolle)

Bild: © vchal, Shutterstock
Probleme, den Stuhlgang zu kontrollieren, haben in der ersten Zeit viele Betroffene mit Darmkrebs. Konnte der Schließmuskel erhalten werden, normalisiert sich dies bei den meisten nach einiger Zeit. Doch einige Patientinnen und Patienten haben längerfristige Probleme mit der Stuhlkontrolle. Man spricht dann auch von Stuhlinkontinenz.
Dafür kann es mehrere Gründe geben: Lag der Tumor nah am After, dann kann die Operation die Funktion des Schließmuskels oder weiterer am Schließvorgang beteiligter Muskeln und Nerven beeinträchtigt haben. Auch eine Strahlentherapie im Beckenbereich führt bei manchen Patientinnen und Patienten zu einer vorübergehenden oder dauerhaften Schädigung dieser Gewebe. Unter Umständen ist nach OP und/oder Bestrahlung auch die Kontrolle über die Harnblase eingeschränkt.
Betroffene mit Inkontinenz brauchen zunächst Geduld: Im Laufe der Zeit kann sich der Körper meist besser auf die neue Situation einstellen. Unter Umständen hilft Beckenbodentraning, die Funktion der betroffenen Muskeln zu verbessern. Eine andere Möglichkeit sind regelmäßige Einläufe oder Darmspülungen, um die Zeit bis zur nächsten Entleerung hinauszuzögern. Auch einige Medikamente können helfen.
- Über alle diese Möglichkeiten können Betroffene mit ihren Ärzten sprechen – Stuhlinkontinenz sollte nicht aus falscher Scham zum Tabuthema werden.
Weitere Unterstützung bieten Physiotherapeutinnen und -therapueuten, Rehabilitationsfachleute oder qualifizierte Ernährungsberaterinnen und -berater. Auch der Austausch mit anderen Betroffenen kann helfen, besser mit der Situation umgehen zu können.
- Wie eine gute Versorgung mit Inkontinenzmaterialien aussehen kann, dazu beraten die Hilfsmittelberaterinnen und -berater der gesetzlichen oder privaten Krankenkasse. Sie erläutern bei Bedarf auch, welche Vertragsfirmen der Versicherung die Produkte zur Stomaversorgung liefern. Auch diese Firmen bieten meist einen Beratungsservice an, ebenso viele Apotheken oder spezialisierte Sanitätshäuser.
Bessern sich die Probleme nicht, dann müssen Ärzte und Betroffene gemeinsam überlegen, ob ein dauerhaftes Stoma eventuell doch die bessere Lösung ist. Die Entscheidung für eine erneute Operation ist aber nicht leicht, sie sollte nicht zu früh und nur unter Abwägung aller möglichen Alternativen getroffen werden.
Weitere belastende Symptome
Im Verlauf der Therapie oder auch als Folge der eigentlichen Krankheit leiden manche Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs unter Beschwerden, die sehr belastend sein können. Viele Nebenwirkungen können heute durch entsprechende Vorbereitung und Unterstützung aufgefangen, gelindert oder ganz vermieden werden.
- Fatigue: Eine lang anhaltende Erschöpfung, die sich auch durch viel Schlaf und Ruhe nicht bessert, erleben manche Betroffene selbst dann, wenn ihre Krebserkrankung eigentlich geheilt werden konnte. Mehr über diese sogenannte Fatigue erfahren Betroffene im Text Fatigue bei Krebspatienten: Was tun bei starker Erschöpfung?.
- Hautprobleme: Chemotherapien und Bestrahlungen belasten Haut und Schleimhäute. Über Symptome, Vorbeugung und Behandlung informiert der Text Nebenwirkungen der Haut durch Therapien gegen Krebs.
- Neuropathie: Manche Chemotherapie-Medikamente können längerfristige Nervenschäden auslösen, sogenannte Neuropathien. Was man zu Vorbeugung und Behandlung heute weiß, erläutern die Texte zu Neuropathie bei Krebspatienten.
- Schmerzen: Vor allem bei Betroffenen mit einer fortgeschrittenen Darmkrebserkrankung, aber auch nach einer Operation, können Schmerzen auftreten. Mehr zu Entstehung und Behandlung in den Texten Schmerztherapie bei Krebspatienten.
- Aszites: Bei manchen Patienten mit sehr fortgeschrittenem Darmkrebs sammelt sich fortlaufend Flüssigkeit im Bauchraum an. Verursacht wird dieser sogenannte Aszites bei den meisten Betroffenen durch Metastasen in der Leber oder im Bauchfell. Was man dagegen tun kann, erläutert der Text Aszites bei Krebspatienten.
Zum Weiterlesen
Zu einigen der hier aufgeführten Probleme bietet der Krebsinformationsdienst auch kurz gefasste Informationsblätter an.
Zu weiteren Symptomen informieren die Texte unter Nebenwirkungen und belastende Symptome bei Krebs.
Sport und Bewegung
Während und nach einer Krebserkrankung müssen Betroffene nicht auf körperliche Aktivität und Sport verzichten. Im Gegenteil: Es gibt viele Belege dafür, dass regelmäßige Bewegung Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Lebensqualität von Krebspatientinnen und -patienten steigert und dabei hilft, die Erkrankung besser zu bewältigen.
- Außerdem zeigen erste Studien, dass Betroffene, die sich regelmäßig bewegen, eine geringere Rückfallrate haben und insgesamt länger leben. Fachleute raten Betroffenen daher zu körperlicher Aktivität.
Wichtig für alle, die bisher keinen Sport betrieben haben: Körperliche Aktivität muss nicht für jeden gleich ein anstrengendes Trainingsprogramm bedeuten. Auch Bewegung im Alltag, etwa bei der Gartenarbeit oder beim Einkaufen zu Fuß statt mit dem Auto, oder gemäßigte Aktivitäten wie Yoga, Tanzen und Spazierengehen sind sinnvoll.
Wer sich mehr bewegen möchte, sollte zunächst mit seiner Ärztin oder seinem Arzt Rücksprache halten: Diese können am besten den Krankheitsverlauf und die körperliche Situation einschätzen und beraten, welches Bewegungspensum und welche Art der Bewegung in der persönlichen Situation sinnvoll und machbar sind.
Partnerschaft und Sexualität

Bild: Tobias Schwerdt © Krebsinformationsdienst, DKFZ
Eine Krebserkrankung wirkt sich bei vielen Betroffenen auf die Beziehung zu den Menschen aus, die ihnen nahestehen: Die körperlichen Belastungen, aber auch die seelischen Folgen und Zukunftsängste beeinflussen das Verhältnis zum Partner oder zur Partnerin. Wer bisher allein gelebt hat, stellt sich unter Umständen die Frage, wie sich die Erkrankung auf eine zukünftige Beziehung auswirken könnte.
Wie wohl man sich im eigenen Körper fühlt, spielt eine wichtige Rolle, wenn es um körperliche Nähe und Intimität geht. Für viele Menschen mit Darmkrebs ist besonders belastend, dass sie zeitweilig die Verdauung nicht wie gewohnt kontrollieren können oder mit einem Stoma leben.
Männer mit Enddarmkrebs sind je nach Lage und Größe ihres Tumors von einer weiteren Therapiefolge betroffen: Nicht immer gelingt es, bei einer Operation Nerven ausreichend zu schonen, die für eine normale Sexualfunktion wichtig sind. Auch bei Frauen kann es durch die Verletzung wichtiger Nerven im Unterbauch zu Empfindungsstörungen kommen.
Selbst in einer stabilen Partnerschaft ist es nicht immer leicht, über diese Probleme zu sprechen. Verdauung ist für viele Menschen nach wie vor ein Tabuthema, Sexualität ein weiteres. Patientinnen und Patienten sollten sich möglichst schon vor der Behandlung genau über die möglichen Folgen aufklären lassen. Am besten fragt man offen danach, welche Nebenwirkungen vorübergehend und welche eventuell dauerhaft auftreten könnten.
Eine Rehabilitation bietet Betroffenen eine gute Gelegenheit, die Themen Partnerschaft und Sexualität in einer neutralen Umgebung und mit professioneller Unterstützung zu klären.
Zum Weiterlesen
Weitere Informationen zum Thema bietet der Text Sexualität und Krebs sowie die Broschüren Weibliche Sexualität und Krebs (PDF) und Männliche Sexualität und Krebs (PDF).
Fruchtbarkeit und Kinderwunsch
Bei jüngeren Betroffenen mit Darmkrebs kann die Fruchtbarkeit durch die Therapie geschädigt werden. Das kann Frauen und Männer betreffen:
- Liegen Eierstöcke oder Hoden im Bestrahlungsfeld oder ist eine umfangreiche Chemotherapie notwendig, kann dies Ei- und Samenzellen schädigen.
- Bei Frauen treten unter Umständen die Wechseljahre zu früh ein.
- Eine Operation kann bei Männern zu Problemen mit der Erektionsfähigkeit führen.
- Bei Frauen kommt es durch die Operation eventuell zu Verwachsungen im Bauchraum, die eine spätere Schwangerschaft erschweren.
- Ein Stoma ist dagegen kein grundsätzliches Hindernis für eine Schwangerschaft. Viele betroffene Frauen haben bereits gesunde Kinder geboren. Patientinnen benötigen aber eine besondere Betreuung während der Schwangerschaft.
Wichtig zu wissen: Pauschale Aussagen zu Fruchtbarkeit und Kinderwunsch sind kaum möglich. Daher sollten sich junge Betroffene auf jeden Fall individuell beraten lassen.
Zum Weiterlesen
Mehr über geeignete Ansprechpartner sowie Informationen zu Vorbeugung und Behandlung von Unfruchtbarkeit bieten die Texte Kinderwunsch nach Krebs.
Familie, Freunde, Arbeitsplatz
Partnerin oder Partner und gegebenenfalls die Kinder können eine wichtige Stütze sein, um eine Krebserkrankung nicht mit sich alleine auszumachen. Sie leiden aber auch mit. Auch Familienangehörige, Freunde oder entfernte Bekannte erfahren früher oder später, dass man krank ist.
Tipps für Betroffene und Angehörige finden Sie unter:
Wenn Eltern Krebs haben: Kindern die eigene Krankheit erklären
Krebs: Hilfe für Familie, Angehörige und Freunde
Beruflicher Wiedereinstieg: Auch am Arbeitsplatz kann Darmkrebs zum Thema werden, wenn man länger fehlt oder nach der Rückkehr nicht gleich voll wieder einsteigt. Denn nach einer Krebserkrankung in den Beruf zurückzukehren, ist nicht immer so einfach wie vielleicht zuerst angenommen.
Zu sozialrechtlichen und beruflichen Fragen gibt es Ansprechpartner, die konkrete Hilfe vermitteln oder Lösungsansätze aufzeigen.
- Mehr zum Thema unter Arbeiten mit einer Krebserkrankung
Darmkrebs: Ansprechpartner finden
Niemand muss eine Darmkrebserkrankung ganz alleine bewältigen. Bei der Krankheitsverarbeitung kann man sich helfen lassen. Patientinnen und Patienten, die in einem Krankenhaus oder einer onkologischen Praxis in Behandlung sind, können sich dort erkundigen, ob es ein spezielles Gesprächsangebot für Krebspatienten gibt.
Auch in Rehabilitationseinrichtungen, Krebsberatungsstellen und psychotherapeutischen Praxen finden Betroffene Unterstützung durch qualifizierte, erfahrene Fachleute. Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Psychologen und Fachärzte helfen, das Erlebte zu bewältigen und unterstützen bei kommenden Herausforderungen:
Krebsberatungsstellen
Der Krebsinformationsdienst bietet ein trägerunabhängiges Verzeichnis der regionalen Krebsberatungsstellen, die in aller Regel kostenfrei Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen beraten: Psychosoziale Krebsberatungsstellen
Spezialisierte psychotherapeutische Praxen
Der Krebsinformationsdienst bietet ein deutschlandweites Verzeichnis von Psychologinnen und Psychoonkologen, die psychotherapeutisch arbeiten:
Praxen ambulant psychotherapeutisch tätiger Psychoonkologen
Informationsblatt "Psychoonkologische Hilfe" (PDF)
Selbsthilfe bei Krebs
Erfahrungen, die andere Menschen mit Darmkrebs gemacht haben, können ganz individuell und doch sehr wertvoll sein: In der Krebsselbsthilfe kann man Information und praktische Tipps bekommen, aber auch Austausch, Zuspruch und Trost finden:
- Eine deutschlandweite Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs ist die Deutsche ILCO e.V. Dort gibt es viel Infomaterial und Austauschmöglichkeiten mit anderen Betroffenen, zum Beispiel in einem Forum.
- Die Inkontinenz-Selbsthilfe e.V. ist ein Verein, der Inkontinenz-Betroffene informieren und den Austausch mit anderen Betroffenen fördern möchte.
- Es gibt weitere Selbsthilfegruppen, die nur regional oder vorwiegend im Internet aktiv sind. Eines von mehreren Beispielen ist die Selbsthilfe Stoma-Welt e.V. Über weitere regionale Initiativen können Krebsberatungsstellen informieren.
- Weitere Anlaufstellen hat der Krebsinformationsdienst im Text Selbsthilfegruppen und Patientenverbände zusammengestellt.
Erfahrungen anderer Darmkrebserkrankter
Auf der Webseite krankheitserfahrungen.de berichten Patientinnen und Patienten über ihre persönlichen Erfahrungen mit Krebs: zum Leben mit einer Krebserkrankung, zu den Behandlungen und zum täglichen Umgang damit. Es gibt einen Bereich speziell zu Darmkrebs.
Auch bei der Initiative Cancer Survivor finden sie Berichte anderer Krebspatientinnen und -patienten – sortiert nach Krebsarten und Themen.
Familiärer Darmkrebs: Beratung für Betroffene und Angehörige
Für die Beratung und Behandlung von Familien mit vererbbarem Krebsrisiko oder dem Verdacht darauf gibt es besondere Anlaufstellen. Adressen und weitere Informationen zu den Zentren finden Sie bei der Deutschen Krebshilfe oder beim Deutschen Konsortium Familiärer Darmkrebs.
Zusätzlich gibt es ein Adressverzeichnis allgemeiner genetischer Beratungseinrichtungen der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik e.V.
Selbsthilfe
- Die Familienhilfe Polyposis coli e.V. ist eine bundesweite Selbsthilfegruppe für Familien, die von der familiären adenomatösen Polyposis (abgekürzt FAP) betroffen sind.
- Es gibt weitere Gruppen, die sich an betroffene Familien mit erblichem Darmkrebs wenden. Sie sind entweder nur regional oder nur über das Internet aktiv oder fungieren organisatorisch nicht nur als Selbsthilfegruppe. Bei der Adresssuche hilft der Krebsinformationsdienst am Telefon und per E-Mail weiter. Auch Ärzte, Kliniken und die regionalen Krebsberatungsstellen helfen weiter.
Fortgeschrittene Krebserkrankung: Beratung und Unterstützung
Weit fortgeschrittener Darmkrebs bedeutet eine große Herausforderung für Patientinnen und Patienten, ihre Angehörigen und enge Freunde: Die Zukunft ist offen, Ängste und Sorgen können den Alltag bestimmen, körperliche Schwäche und Beschwerden erschweren die Situation.
- Eine kurz gefasste Übersicht bietet das Informationsblatt "Fortgeschrittene Krebserkrankung" (PDF).
- Tipps und Ansprechpartner bei häuslicher Pflege bietet der Text So wird häusliche Krankenpflege organisiert: Ansprechpartner.
Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise
Der Krebsinformationsdienst hat zur Erstellung des Textes im Wesentlichen auf die S3-Behandlungsleitlinie deutscher Fachgesellschaften zurückgegriffen. Diese und weitere Quellen sowie nützliche Links sind in der Übersicht zum Thema Darmkrebs aufgeführt.
Fachartikel
Die im Folgenden aufgeführten Artikel stellen eine Auswahl genutzter Quellen und Hintergrundinformationen dar. Fachveröffentlichungen liegen überwiegend in englischer Sprache vor, sie richten sich an vorinformierte Leser und sind meist nur über wissenschaftliche Bibliotheken oder kostenpflichtige Onlinedienste zugänglich.
Guinter MA, McCullough ML, Gapstur SM, Campbell PT. Associations of Pre- and Postdiagnosis Diet Quality With Risk of Mortality Among Men and Women With Colorectal Cancer. J Clin Oncol. 2018 Oct 19:JCO1800714. doi:
McGettigan M, Cardwell CR, Cantwell MM, Tully MA. Physical activity interventions for disease‐related physical and mental health during and following treatment in people with non‐advanced colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 5. Art. No.: CD012864. DOI: 10.1002/14651858.CD012864.pub2.
Sharp L, McDevitt J, Brown C, Comber H. Smoking at diagnosis significantly decreases 5-year cancer-specific survival in a population-based cohort of 18 166 colon cancer patients. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Feb 8. doi: 10.1111/apt.13944
Song M, Wu K, Meyerhardt JA, Ogino S, Wang M, Fuchs CS, Giovannucci EL, Chan AT. Fiber Intake and Survival After Colorectal Cancer Diagnosis. JAMA Oncol. 2017 Nov 2. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.3684. [Epub ahead of print]
Zhu B, Wu X, Wu B, Pei D, Zhang L, Wei L. The relationship between diabetes and colorectal cancer prognosis: A meta-analysis based on the cohort studies. PLoS One. 2017 Apr 19;12(4):e0176068. doi: 10.1371/journal.pone.0176068. eCollection 2017.