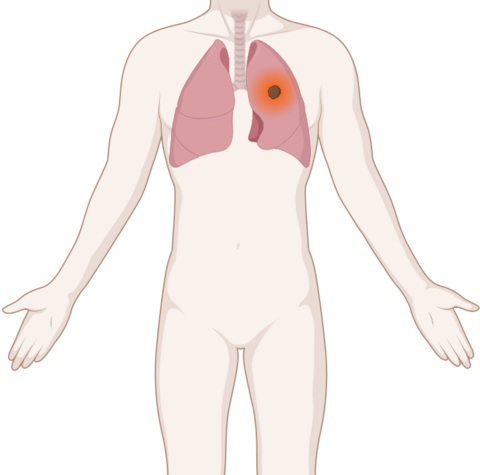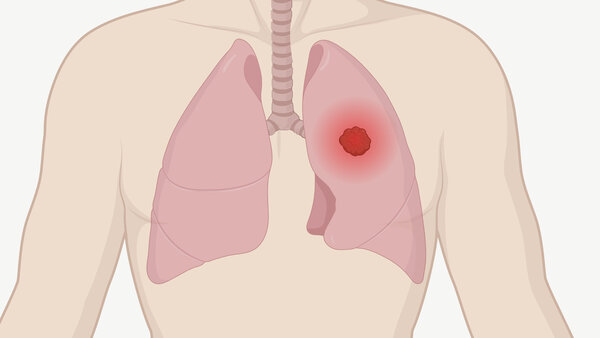- In Deutschland haben etwa 15 von 100 Betroffenen mit Lungenkrebs ein kleinzelliges Bronchialkarzinom (SCLC, englisch für "small cell lung cancer").
- Kleinzellige Lungenkarzinome wachsen in der Regel schnell und bilden früh Metastasen. Daher haben die meisten Betroffenen bei der Diagnose einen Tumor im weit fortgeschrittenen Stadium.
- Wichtigster Teil der Behandlung eines SCLC ist in der Regel eine Chemotherapie. Sie wird abhängig vom Stadium und der individuellen Erkrankungssituation mit anderen Therapiemaßnahmen kombiniert. Liegen Metastasen vor, erhalten Betroffene nach Möglichkeit eine Chemo-Immuntherapie.
Hinweis
Patientinnen und Patienten mit Lungenkrebs sollten sich in einem Zentrum mit Erfahrung in der Therapie von Lungenkrebs behandeln lassen. Dort arbeiten Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen zusammen. Wie Betroffene ein solches Zentrum finden erklären wir im Text Lungenkrebs: Behandlungsmöglichkeiten und Nebenwirkungen im Abschnitt Spezialisten und Ansprechpartner.
Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.
Krankheitsstadien des kleinzelligen Bronchialkarzinoms (SCLC)
Es gibt 4 Krankheitsstadien des kleinzelligen Lungenkarzinoms (SCLC), die in weitere Untergruppen unterteilt sind. In welches dieser Stadien I – IV die Ärzte einen Tumor einordnen, hängt von der Ausdehnung des Tumors (T), dem Lymphknotenbefall (N) und dem Vorhandensein von Metastasen (M) ab.
Zum Weiterlesen
Mehr zur Stadieneinteilung nach dem TNM-System lesen Sie unter Diagnose Lungenkrebs: Untersuchungen bei Krebsverdacht.
Bei den meisten Patienten (60 bis 70 von 100) mit kleinzelligem Lungenkrebs, hat der Tumor bereits in die andere Lungenseite gestreut oder Metastasen in Organen gebildet (Fernmetastasen, Stadium IV).

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt
Welche Behandlung die Ärzte vorschlagen, hängt neben anderen Faktoren vor allem davon ab, ob bereits Metastasen vorliegen oder nicht.
Gut zu wissen: Medizinische Behandlungsleitlinien verwenden außerdem noch eine ältere Einteilung in 3 Stadien:
- "Very limited disease", sinngemäß übersetzt "sehr begrenztes Erkrankungsstadium"
- "Limited disease" (LD), sinngemäß übersetzt "begrenztes Erkrankungsstadium"
- "Extensive disease" (ED), sinngemäß übersetzt "ausgebreitetes Erkrankungsstadium"
Fragen Sie uns!
Ihre behandelnden Ärzte sind die wichtigsten Ansprechpersonen, wenn es um Ihre Behandlung geht. Wenn Sie mehr wissen möchten oder etwas nicht verstanden haben, sprechen Sie Ihre Ärztin oder ihren Arzt noch einmal gezielt darauf an.
Brauchen Sie Hintergrundinformationen oder Hilfe, um das Gespräch vorzubereiten? Dann helfen Ihnen die Ärztinnen und Ärzte des Krebsinformationsdienstes weiter:
- am Telefon kostenlos unter 0800 – 420 30 40, täglich von 8 bis 20 Uhr
- per Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de (datensicheres Kontaktformular)
Therapie des SCLC im metastasierten Stadium
Hat das kleinzellige Lungenkarzinom (SCLC) bereits Metastasen ausgebildet? Dann geht es vor allem darum, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern. Heilbar ist kleinzelliger Lungenkrebs im weit fortgeschrittenen Stadium in der Regel nicht mehr.
Da sich die Zellen eines SCLC sehr schnell teilen, reagiert es besonders empfindlich auf eine Chemotherapie. Deshalb ist die Chemo in der Regel ein wichtiger Teil des Behandlungsplans. Die Neuzulassungen von sogenannten Immun-Checkpoint-Hemmern – Wirkstoffe der Immuntherapie bei Krebs – haben die Behandlungsmöglichkeiten zusätzlich verbessert.
Gut zu wissen
Planen Ihre Ärzte die Behandlung, werden sie auch Ihre körperliche Belastungsfähigkeit und Ihre Wünsche berücksichtigen.
Chemotherapie plus Immuntherapie – neuer Standard bei metastasiertem SCLC: Patientinnen und Patienten mit metastasiertem kleinzelligem Lungenkrebs erhalten nach Möglichkeit eine Kombination aus
- einer Chemotherapie mit den Wirkstoffen Cisplatin oder Carboplatin und Etoposid und
- einer Immuntherapie mit dem Immun-Checkpoint-Hemmer Atezolizumab oder Durvalumab.
Spricht der Tumor an, erhalten Betroffene anschließend weiterhin eine alleinige Immuntherapie.
Zum Weiterlesen
Einen Überblick zur Chemotherapie und Immuntherapie bei Lungenkrebs erhalten Sie in dem Text Therapieverfahren bei Lungenkrebs.
Vorbeugung und Behandlung von Hirnmetastasen
Spricht der Lungentumor der Patientin oder des Patienten auf die Chemo an? Dann kann es sein, dass das Behandlungsteam vorschlägt, vorbeugend das Gehirn zu bestrahlen. Das soll verhindern, dass sich Tumorzellen im Gehirn festsetzen und Hirnmetastasen bilden.
Ob Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium tatsächlich von einer vorbeugenden Hirnbestrahlung profitieren, ist allerdings noch nicht ganz klar. Zudem kann eine Ganzhirnbestrahlung Nebenwirkungen haben, etwa Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen. Deshalb können Betroffene ihr Gehirn auch regelmäßig mit einer Kernspinuntersuchung (MRT) kontrollieren lassen. So können sie frühzeitig behandelt werden, wenn Hirnmetastasen neu auftreten.
Hat die Patientin oder der Patient bereits Hirnmetastasen? Dann werden Ärzte diese möglichst schnell bestrahlen. Das gilt vor allem dann, wenn die Hirnmetastasen Symptome verursachen.
Zum Weiterlesen
Therapie des SCLC ohne Fernmetastasen
Bei den meisten Betroffenen mit kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) ist es selbst in frühen Stadien nicht möglich, den Tumor mit einer alleinigen Operation zu behandeln. Sie bekommen in der Regel zusätzlich eine Chemotherapie.
Ist eine Operation nicht möglich, setzen Ärzte meistens eine Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie ein – die sogenannte Radiochemotherapie.
Operation und Chemotherapie
Wichtig zu wissen
Manchmal wäre es bei einer OP notwendig einen kompletten Lungenflügel zu entnehmen, um den Tumor vollständig zu entfernen. Dann empfehlen Fachleute eine Radiochemotherapie anstelle der Operation.
Voraussetzung für eine Operation des kleinzelligen Lungenkarzinoms ist,
- dass der Tumor klein ist und keine Lymphknoten zwischen den beiden Lungenflügeln befallen sind.
- dass der Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten eine Operation zulässt.
Wenn die Ärzte den Tumor operieren, empfehlen sie anschließend eine Chemotherapie. So lassen sich eventuell vorhandene Tumorreste zerstören. Ziel ist es, einen Rückfall möglichst zu verhindern. Eine Operation allein verlängert das Überleben in der Regel nicht.
Außerdem kann es sein, dass die Ärzte eine vorbeugende Bestrahlung des Gehirns vorschlagen. Diese soll verhindern, dass Hirnmetastasen auftreten. Die Bestrahlung senkt dieses Risiko, kann aber nicht sicher verhindern, dass Hirnmetastasen entstehen.
Manchmal erhalten Betroffene auch zusätzlich eine Bestrahlung des Mediastinums: Das ist der Raum zwischen den Lungenflügeln. Ob das gemacht wird, hängt davon ab,
- ob und welche Lymphknoten befallen sind und
- ob der Tumor vollständig entfernt werden konnte.
Zum Weiterlesen
Was machen Ärzte bei einer Operation in der Lunge? Wie kann man sich auf die Operation vorbereiten? Mehr dazu finden Sie im Text Therapieverfahren bei Lungenkrebs.
Radiochemotherapie
Erhalten Betroffene mit kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) eine Radiochemotherapie, setzen Ärzte zusätzlich zur Chemotherapie eine Bestrahlung ein. Fachleute empfehlen üblicherweise, diese schon während der Chemotherapie zu beginnen. Die Strahlentherapie kann aber auch im Anschluss an die Chemotherapie beginnen, wenn die Belastung durch die zeitgleiche Behandlung für die Betroffenen zu groß ist.
Chemotherapie: Für die Chemotherapie kombinieren Ärzte in der Regel die 2 Wirkstoffe Cisplatin und Etoposid. Fachleute empfehlen normalerweise mindestens 4 Zyklen Chemotherapie über 3 Wochen mit Pausen dazwischen. In dieser Zeit soll sich das gesunde Gewebe von der Chemotherapie erholen. Gibt es gesundheitliche Einschränkungen, die gegen Cisplatin sprechen, können die Ärzte bei der Chemo auch auf andere Wirkstoffkombinationen ausweichen.
Strahlentherapie: Abhängig von der individuellen Erkrankungssituation erhalten Patientinnen und Patienten
- eine sogenannte "hyperfraktionierte akzelerierte Strahlentherapie" oder
- eine Strahlentherapie mit herkömmlicher Fraktionierung.
Diese beiden Bestrahlungsarten unterscheiden sich darin, mit welcher Einzeldosis und in welchen Abständen Betroffene bestrahlt werden. Mehr dazu lesen Sie im Text Therapieverfahren bei Lungenkrebs.
Wenn der Lungentumor auf die Radiochemotherapie anspricht: Dann empfehlen Fachleute nach Abschluss der Therapie außerdem
- eine vorbeugende Bestrahlung des Gehirns.
- eine 2-jährige Erhaltungstherapie mit einem Immun-Checkpoint-Hemmer.
Therapie eines Rückfalls
Ein Großteil der Betroffenen mit einem kleinzelligen Bronchialkarzinom (SCLC) im frühen Stadium bekommt trotz Therapie nach einer Weile einen Rückfall, ein sogenanntes "Rezidiv".
Welche Therapie dann infrage kommt, hängt davon ab, ob das Rezidiv
- an der Stelle des ursprünglichen Tumors auftritt (Lokalrezidiv) oder ob es
- in Form von Metastasen auffällt (systemisches Rezidiv).
Für die Wahl der Behandlung ist außerdem auch der Zeitraum zwischen der ursprünglichen Behandlung und dem Auftreten des Rezidivs wichtig.
Zur Wahl stehen verschiedene Chemotherapien – oft kommt der Wirkstoff Topotecan zum Einsatz. Für manche Patientinnen und Patienten mit einem Lokalrezidiv kommt eine Operation oder Bestrahlung infrage.
Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an hilfreichen Links zum Weiterlesen und Quellen, die für die Erstellung dieses Textes genutzt wurden.
Quellen und weiterführende Informationen
Leitlinien
Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Lungenkarzinoms, Langversion 4.0, 2025, AWMF-Registernummer: 020/007OL, abgerufen am 16.06.2025.
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie (DGHO):
- Onkopedia-Leitlinie für Lungenkarzinom, nicht-kleinzellig (NSCLC), Stand 04/2025, abgerufen am 12.06.2025
- Onkopedia-Leitlinie für Lungenkarzinom, kleinzellig (SCLC), Stand 01/2023 abgerufen am 12.06.2025
Arzneimittel: Herstellerinformationen, Studien, Nutzenbewertungen
Als Quelle für Aussagen zu Medikamenten hat der Krebsinformationsdienst aktuelle Fachinformationen der Hersteller herangezogen (über www.fachinfo.de für Fachkreise zugänglich). Außerdem greift der Krebsinformationsdienst auf frei zugängliche Informationen zu, wie
- Arzneimittelinformationen in deutschen Datenbanken, vor allem im Arzneimittel-Informationssystem des Bundes PharmNet.Bund.
- aktuelle Hinweise des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI).
- die Informationen der europäischen Arzneimittelbehörde EMA.
Zu neueren Arzneimitteln werden als Quelle auch Nutzenbewertungen gemäß § 35a des SGB V herangezogen. Die bisher vorliegenden Berichte sind abrufbar beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) unter dem Stichwort "Projekte & Ergebnisse", dann "Publikationen".
Auch der Gemeinsame Bundessausschuss (G-BA) bietet Informationen zu Arzneimitteln. In der Regel handelt es sich dabei um Änderungen der Arzneimittel-Richtlinie.