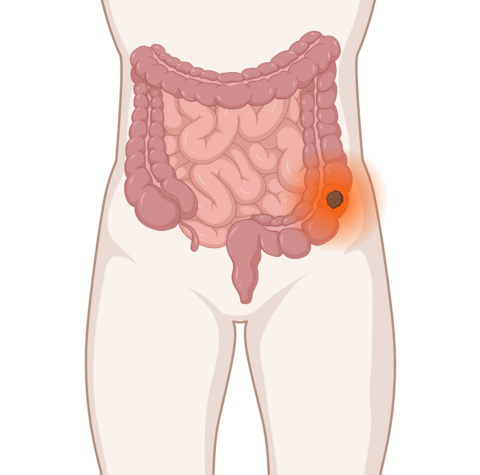- Für Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs stehen verschiedenen Therapien zur Verfügung: Dazu gehören Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und die Behandlung mit zielgerichteten Medikamenten.
- Welche Therapie geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab: zum Beispiel vom Krankheitsstadium und vom Allgemeinzustand der oder des Betroffenen, aber auch von persönlichen Wünschen und Vorstellungen.
- Der folgende Text gibt einen Überblick über die Therapiemöglichkeiten und gibt Hinweise für mögliche Fragen an die Ärzte.
Wichtig: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.
Darmkrebs: Ansprechpartner und Spezialisten
Auf die Therapie von Darmkrebspatientinnen und -patienten sind viele Kliniken eingerichtet, zum Beispiel Universitätskliniken oder größere städtische und regionale Krankenhäuser. Hinzu kommen die sogenannten onkologischen Spitzenzentren, die Patientinnen und Patienten häufig die Teilnahme an klinischen Studien anbieten.
Spezialisierte Kliniken haben die Möglichkeit, ihre besondere Eignung als "Darmkrebszentrum" zertifizieren zu lassen.
- Im Auftrag der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Darmkrebszentren finden sich unter www.oncomap.de. Dafür müssen Sie in dem Auswahlmenü "Tumore" die Kategorie "Darm" auswählen.
- Onkologische Spitzenzentren, die nicht auf eine bestimmte Tumorart spezialisiert sind, werden von der Deutschen Krebshilfe gefördert: Eine Suchmöglichkeit bietet die Seite www.ccc-netzwerk.de.
- Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren bietet Adressen unter www.tumorzentren.de/mitglieder.html.
- Für chirurgische Abteilungen, die sich auf Operationen bei Darmkrebs spezialisiert haben, gibt es eine eigene Zertifizierung. Sie wird in Zusammenarbeit der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Coloproktologie (CACP), der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) und der Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie (DGK) durchgeführt. Eine Liste der zertifizierten Zentren findet sich unter www.dgav.de/zertifizierung/zertifizierte-zentren/chirurgische-koloproktologie.html.
Ambulante Betreuung: Sowohl Kliniken mit Zulassung für die ambulante Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen als auch niedergelassene onkologisch qualifizierte Ärzte können ambulante Therapien bei Darmkrebs durchführen.
Zum Weiterlesen
Überblick: Therapiemöglichkeiten bei Darmkrebs
Welche Behandlungsverfahren für Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs infrage kommen, richtet sich nach den Ergebnissen der Voruntersuchungen: Wo liegt der Tumor genau? Wie groß ist er? Hat er sich bereits über den Darm hinweg ausgebreitet? Wie sind seine molekularbiologischen Eigenschaften? Aber auch Faktoren wie etwa der Allgemeinzustand und eventuell vorliegende Begleiterkrankungen spielen eine Rolle.
Zum Weiterlesen
Behandlung bei Krebsvorstufen und sehr frühen Tumoren
Bei Krebsvorstufen und sehr kleinen, oberflächlichen Tumoren reicht unter Umständen eine endoskopische Entfernung aus. Solche Tumoren sind meist als sogenannte Darmpolypen sichtbar: als wenige Millimeter bis einige Zentimeter große Verdickungen und Vorwölbungen der Darmschleimhaut. Die Ärztin oder der Arzt kann sie schon während der ersten Darmspiegelung entfernen – auch wenn diese eigentlich als Früherkennungsuntersuchung oder zur Abklärung von Beschwerden gedacht war.
Voraussetzung dafür ist: Es handelt sich um eine (noch) harmlose Krebsvorstufe oder einen wenig aggressiven Tumor. Der Tumor darf nicht den gesamten Polypen ausmachen und nicht in tiefere Gewebeschichten des Darms eingewachsen sein. Diese Eigenschaften können Pathologinnen und Pathologen unter dem Mikroskop beurteilen.
Zum Weiterlesen
Wie eine Darmspiegelung funktioniert, lesen Sie unter Darmspiegelung: Bilder aus dem Darm.
Mehr zur Einteilung von Darmpolypen und ihrem Risiko, bösartig zu werden, finden Sie im Text Darmkrebs: Befunde verstehen unter dem Stichwort "Darmpolypen".
Behandlung bei auf den Darm begrenzter Erkrankung
Handelt es sich nicht um einen frühen Tumor, dann kommt für viele Patientinnen und Patienten eine Operation infrage. Können die Ärzte bei einem solchen Eingriff alles Tumorgewebe entfernen, ermöglicht die Operation eine Heilung.
Wie umfangreich der Eingriff sein muss, hängt von der Größe des Tumors ab, und davon, wie weit er in die Darmwand und angrenzende Lymphknoten vorgedrungen ist. Aber auch die Lage des Tumors spielt eine Rolle für die Behandlungsplanung.
Für Betroffene mit Dickdarmkrebs (Kolonkarzinom) gilt:
- Bei höherem Rückfallrisiko folgt nach der Operation eine ergänzende Behandlung mit einer Chemotherapie.
Für Patientinnen und Patienten mit Enddarmkrebs (Rektumkarzinom) gilt:
- Wichtig für die Behandlungsplanung ist die Frage, ob der Schließmuskel erhalten bleiben kann. Ist das nicht möglich, erhalten Betroffene einen dauerhaften künstlichen Darmausgang, ein sogenanntes Stoma.
- Unter Umständen lassen sich die Möglichkeiten zu operieren durch eine vorgeschaltete (neoadjuvante) Chemo- und Strahlentherapie verbessern: Diese Behandlung kann den Tumor verkleinern, sodass der Eingriff weniger umfangreich wird und die Chancen für einen Erhalt des Schließmuskels steigen.
- Sind nach der Strahlen- und Chemotherapie keine Krebszellen mehr nachweisbar, dann kann man unter Umständen sogar auf eine Operation verzichten. Betroffene werden stattdessen engmaschig kontrolliert.
- War dagegen eine Operation die erste Behandlung, dann erfolgt je nach Rückfallrisiko eine zusätzliche, sogenannte adjuvante Chemo- oder Chemo-Strahlentherapie im Anschluss.
Behandlung bei fortgeschrittener Erkrankung
Für Patientinnen und Patienten mit einer weiter fortgeschrittenen Darmkrebserkrankung gibt es unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten.
Bei manchen Patientinnen und Patienten mit Metastasen ist eine Operation möglich: Haben sich Absiedlungen des Tumors in Leber, Lunge oder Bauchfell gebildet, können die Ärzte sie unter Umständen gezielt entfernen. Ob das möglich ist, hängt von Lage, Größe und Anzahl der Metastasen ab. Droht ein Darmverschluss, versuchen die Chirurgen, die Darmpassage wiederherzustellen. Auch dann wird eine Operation notwendig.
Kommt eine Operation nicht infrage, dann erhalten Betroffene eine Chemotherapie. Sie wird je nach Situation ergänzt durch zielgerichtete Medikamente: Diese greifen gezielt in biologische Prozesse ein, die Wachstum und Vermehrung von Tumorzellen vermitteln. Für manche Betroffene kommt auch eine Immuntherapie mit Checkpoint-Hemmern infrage. Mit einer solchen Therapie soll das Tumorwachstum möglichst lange gebremst werden.
Zur Krebstherapie gehören für Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung auch Therapien, die Beschwerden lindern, die durch die Krankheit selbst oder durch belastende Therapien verursacht werden. Ein Beispiel ist bei Bedarf eine wirksame Schmerztherapie. Bei manchen Patientinnen und Patienten führt eine fortgeschrittene Erkrankung zu Flüssigkeitsansammlungen im Bauchraum, einem sogenannten Aszites. Die Therapie zielt dann darauf ab, Betroffenen eine Entlastung vom Druck dieser Flüssigkeit und damit Erleichterung zu verschaffen.
Teilnahme an klinischen Studien
Für manche Patientinnen Patienten mit Darmkrebs kommt auch die Teilnahme an einer klinischen Studie infrage: In solchen Studien werden experimentelle Verfahren erprobt, also beispielsweise neue Medikamente oder Operations- oder Bestrahlungsverfahren. Es gibt aber auch Studien, die der Verbesserung der bisherigen Behandlung dienen: In diesen Therapieoptimierungsstudien werden bereits bekannte und übliche Methoden neu kombiniert oder leicht abgewandelt.
- Hintergründe bieten die Texte zur Krebsforschung in klinischen Studien.
Behandlung in besonderen Situationen
Wird die Diagnose Darmkrebs erst wegen eines Darmverschlusses gestellt? Dann bleibt meist keine Zeit für umfangreiche Voruntersuchungen vor einer Operation. Daher gibt es für solche und ähnliche Notfallsituationen keine festen Vorgaben: Die Ärzte orientieren sich bei der Behandlung daran, was die Lage ihrer Patientin oder ihres Patienten aktuell erfordert.
Sind Patientinnen und Patienten an erblich bedingtem Darmkrebs erkrankt? Dann ist unter Umständen eine größere Operation notwendig als bei anderen Betroffenen: Denn das Rückfallrisiko ist bei erblich bedingtem Darmkrebs häufig sehr viel höher.
- Mehr zu solchen risikosteigernden Genen finden Interessierte im Text Darmkrebs: Risikofaktoren und Vorbeugung.
Komplementäre oder alternative Verfahren bei Darmkrebs
Einige Krebserkrankte hoffen auf den Nutzen alternativer oder komplementärer (ergänzender) Behandlungsmethoden. Sie möchten damit Nebenwirkungen der Therapien mildern und die Lebensqualität verbessern. Ein weiteres Motiv: der Wunsch, möglichst nichts zu versäumen, was zur Heilung oder Verhinderung eines Rückfalls beitragen könnte.
Das Problem: Für viele dieser Angebote gibt es keinen wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis. Für manche Methoden fehlen aussagekräftige und wissenschaftlich hochwertige Studien. Bei anderen Verfahren konnte in Studien sogar belegt werden, dass sie nicht wirken. Manche Mittel können nachweislich sogar die Wirksamkeit einer Chemo- oder Strahlentherapie mindern oder Nebenwirkungen verstärken.
Fachleute bewerten in der aktuellen ärztlichen Leitlinie zu Darmkrebs das Wissen zu einigen häufiger verwendeten Methoden:
- Keinen nachgewiesenen Nutzen sehen die Fachleute zum Beispiel bei vielen pflanzlichen Präparaten, bei Heilpilzen, Homöopathie und für Präparate der traditionellen chinesischen oder der Ayurveda-Medizin.
- Auch bei Mistelpräparaten fanden die Experten keine wissenschaftlich fundierten Studien, die einen Überlebensvorteil für Krebserkrankte zeigten. Es gibt Hinweise darauf, dass sie die Lebensqualität verbessern können. Doch die entsprechenden Studien weisen ebenfalls Mängel auf.
- Von alternativen Behandlungsmethoden, die anstelle der empfohlenen Therapie eingesetzt werden sollen, raten die Fachleute ab. Dazu gehören zum Beispiel Ukrain, Aprikosenkerne ("Vitamin" B17), eine kohlenhydratarme Krebsdiät und die "Neue Germanische Medizin".
Es gibt aber Hinweise darauf, dass ergänzende (komplementäre) Entspannungs- und Achtsamkeitsverfahren wie Yoga oder Tai-Chi therapiebedingte Beschwerden mindern und den Umgang mit der Erkrankung erleichtern können. Akupunktur und Akupressur können gegebenenfalls therapiebedingte Übelkeit und Erbrechen lindern und die Schmerztherapie hilfreich ergänzen.
Wichtig: Patientinnen und Patienten, die ergänzend zu ihrer Behandlung Präparate einnehmen oder Verfahren einsetzen möchten, sollten ihre Ärzte darüber informieren: Sie können mögliche Nebenwirkungen erkennen, aber auch auf Wechselwirkungen hinweisen, die ein Mittel mit der laufenden Therapie haben kann.
Fragen an die Ärzte

Bild: © Krebsinformationsdienst, DKFZ; Foto: Tobias Schwerdt
Die Behandlung planen Ärzte und Betroffene gemeinsam. Möchten Sie bei der Wahl der Therapie mitentscheiden, dann benötigen Sie ausführliche Informationen. Aber auch wenn Sie die Entscheidung den Ärzten überlassen möchte, helfen Informationen bei der Einschätzung, wie die Therapie abläuft und mit welchen Krankheits- und Therapiefolgen Sie rechnen müssen.
Die folgenden Fragen sollen es Ihnen erleichtern, sich auf das Gespräch mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt vorzubereiten.
- Wie ist meine Erkrankungssituation?
- Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für mich?
- Was sind die Vor- und Nachteile, falls es mehrere Möglichkeiten gibt?
- Wie groß ist die Chance, dass die Therapie bei mir wirkt?
- Wie läuft die Behandlung ab? Wie lange dauert sie?
- Mit welchen Nebenwirkungen und Folgen muss ich voraussichtlich rechnen? Was lässt sich dagegen tun?
- Was kann ich selbst tun, um den Behandlungserfolg zu unterstützen?
- Was passiert, wenn ich mich nicht behandeln lasse?
- Gibt es weitere Unterstützungsmöglichkeiten, die ich in Anspruch nehmen kann?
Zögern Sie auch nicht, Fragen zu Ihren persönlichen Befürchtungen und Ängsten zu stellen. Lassen Sie sich nach Möglichkeit von Angehörigen oder Freunden zum Arztgespräch begleiten: So verhindern Sie, Details in der Aufregung zu überhören. Und Sie können sich hinterher über das Gespräch austauschen.
Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise
Der Krebsinformationsdienst hat zur Erstellung des Textes im Wesentlichen auf die S3-Behandlungsleitlinie deutscher Fachgesellschaften zurückgegriffen. Diese und weitere Quellen sowie nützliche Links sind in der Übersicht zum Thema Darmkrebs aufgeführt.